 |
 |
 |
  |

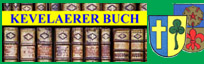 |
INHALTSVERZEICHNIS |
|
|
|
|
| Kapitel 1 von 115 |
Mai 1949
Die Gnadenkapelle ist auch vor Beginn der Wallfahrtszeit ein stiller Hort, wo Sorgen abgeladen werden. Unter den Betern ist eine teilweise gelähmte Frau aus Krefeld, der Wunderbares widerfährt: Sie hat keine Beeinträchtigungen mehr, als sie Kevelaer in aller Stille verlässt. So erzählt man es sich in der Stadt. Die Frau ist nicht aufzuspüren.
Ende Mai wird eine Jugendherberge für Mädchen eröffnet - eine für Jungen gibt es bereits. Betten für 15 Mädchen bietet das neue Refugium, gelegen bei Grevers am Wettener Feld, initiiert von Rektorin Elisabeth Ender und Rektor Franz Bourgeois.
Zehn Jahre sind seit der letzten Kirmes in Kevelaer vergangen. Nun freuen sich die Bürger auf die Nachkriegspremiere. Sie soll wieder im alten Stil mit Festzug der Geselligen Vereine durch die Straßen des Orts gefeiert werden, natürlich auch mit Übergabe der Festkette. Es ist eine neue, denn das gute Stück hat ein alliierter Soldat mitgehen lassen. Die neue wird in Gemeinschaftsarbeit von Goldschmieden nach einem Bild gefertigt.
Zu den Kirmesgeschäften zählt natürlich auch ein Panoptikum, in dem Abstruses gezeigt wird; dazu gesellen sich Raketenbahn, Schießbuden - die Besatzer erlauben den Gebrauch von Luftbüchsen -, Selbstfahrer, Schiffschaukel, Rutschbahn und die berühmte Raupe, in der ein Pärchen ein paar Sekunden lang knutschen kann.
Am 30. Mai überreicht Bürgermeister Peter Plümpe, assistiert von Amtsdirektor Fritz Holtmann und einigen Ratsmitgliedern, die neue Festkette an Matthias Janssen von der St.- Antonius-Gilde.
Beim Festumzug in Kevelaer passiert ein Malheur: Robert Platzer, der Vorsitzende der St.-Quirinus-Bruderschaft Schravelen, fällt vom Pferd und bricht sich ein Bein. Das Missgeschick ist bald vergessen: Wenige Tage später feiern die Schravelener ungetrübt ihr erstes Vogelschießen nach dem Krieg. Geschossen wird mit der Armbrust, die von den Johannes-Schützen ausgeliehen worden ist. Hermann van Eickels wird König, Antonia Schlootz Königin.
Einen Festtag kann auch der junge Bauhandwerker Heinrich Jansen begehen. Zwei Jahre zuvor aus russischer Gefangenschaft heimgekehrt, besteht er seine Meisterprüfung. Im folgenden Jahr wird er mit seinem Bruder Peter das väterliche Baugeschäft von 1878 übernehmen.
In Kevelaer und Umgebung kommt die Bautätigkeit nur schleppend in Gang. Entsprechend hoch ist die Arbeitslosigkeit. Zu tun ist genug, aber die im Jahr zuvor eingeführte D-Mark ist knapp. An Kredite ist nur schwer zu kommen. Besonders schlimm wirkt sich der Engpass für Landwirte aus: Maschinen und Geräte, die sie dringend brauchen, sind so unverhältnismäßig teuer, dass die Finanzierungskosten bei weitem nicht von den Einnahmen gedeckt werden. Vielen Bauern droht Überschuldung.
Juni 1949
Die Behörden, die sich um die Bedürftigen kümmern müssen, sehen kaum Land. Mehr als jeder zehnte Einwohner im Kreis Geldern ist Flüchtling. Die Welle von Zuwanderung heimatloser Menschen ebbt nicht ab.
Gelegentlich melden die Zeitungen auch etwas Erfreuliches: Am 1. Juni inseriert Tilla Geenen für die Winnekendonker Restauration Zur Brücke ihre Wiedereröffnung: „Gepfl. Getränke - Kaffee - Schnittchen - Rauchwaren wie früher“. Und: „In Kürze wieder Kegelbahn.“
Auch das gibt es: Im Achterhoek wird mit dem Bau der Josefskapelle begonnen. Architekt Glitz hat sie entworfen. Die ausführende Baufirma Görtz kann auf viele freiwillige Helfer zurückgreifen.
Richtfest feiert die neue Schule in Winnekendonk, die August Wormland (Amtsdirektor) und Wilhelm Wehren (Bürgermeister) zu verdanken ist. Bald wird die Zeit, in der die Kinder in Nissenhütten und Gaststätten unterrichtet werden müssen, vorbei sein.
In Twisteden darf mit Genehmigung der britischen Militärs ein Sportverein gegründet werden. Vorsitzender der DJK wird Gerhard Koenen, Pastor August Hegenkötter ist Präses und damit geistlicher Begleiter des Vereins, der zur größten und gesellschaftlich bedeutsamsten Einrichtung in Twisteden heranwachsen wird.
In dieser Aufbruchzeit ist die Erinnerung an den Krieg stets gegenwärtig. Bis Mitte Juni sind 50 Deutsche von den Militärs dienstverpflichtet gewesen, jedes Grundstück nach Minen abzusuchen. Jetzt ist der Regierungspräsident zuständig; er regelt die Minensuche neu.
In den „Amtlichen Bekanntmachungen“ der Zeitungen erscheinen Aufgebote, in denen Ehefrauen die „Tot-Erklärung“ ihrer Ehemänner beantragen. Im Text heißt es: „Die bezeichneten Verschollenen werden aufgefordert, sich spätestens (Datum) zu melden, widrigenfalls die Todeserklärung erfolgen wird.“ Diese amtlichen Vorgänge sind auch wirtschaftlich wichtig für die Hinterbliebenen und ihre Versorgung.
In Twisteden werden an der alten Schule zwei Schulräume angebaut. Bisher müssen sich 211 Schüler zwei Klassenräume und ein Gastwirtszimmer teilen.
In Kevelaer liegt Pastor Wilhelm Holtmann, der Hüter des Heiligtums während der Nazi-Zeit, im Sterben. Millionen Menschen sind im Lauf der Jahrhunderte zum Gnadenbild gepilgert, nun kommt es - wohl zum ersten und einzigen Mal in der Geschichte - zu einem Sterbenden. Holtmanns Vertreter, Fritz Dyckmans, holt es aus dem Schrein in seiner engster Fassung, geschützt durch sieben Scheiben, und bringt es unbemerkt ins Marienhospital ans Bett des Pastors. Wilhelm Holtmann stirbt, zwei Tage danach, am 24. Juni.
Die Nachrufe füllen Zeitungsseiten. „Heimgang eines großen Mannes“, heißt es in einem der Nachrufe, „Persönlicher Freund des Kardinals Clemens August von Galen“, „Einer der warmherzigsten und eifrigsten Förderer des ‚Pax-Christi‘-Gedankens“, „Hüter des Kevelaerer Heiligtums“ und „unermüdlicher Friedensbote“.
Dechant Holtmann wird unter Teilnahme der Weihbischöfe Dr. Gleumes und Dr. Roleff zu Grabe getragen. Abordnungen aus Holland und Luxemburg erscheinen zur Beerdigung. Sein Grab am Fuß des Hochkreuzes auf dem Friedhof im Marienpark wird bis heute in Ehren gehalten. „Hüter des Heiligtums der Trösterin der Betrübten in schwerer Zeit“ steht auf einer bronzenen Tafel.
Geschichte wiederholt sich normalerweise nicht, in diesem Fall tut sie es: Als der hochgeschätzte Wallfahrtsrektor stirbt, befindet sich Kevelaer unmittelbar vor der großen Feier zur Stadterhebung. Als einer seiner Vorgänger, Joseph van Ackeren, starb (1903), stand Kevelaer vor der Eröffnung des neuen Rathauses.
Jetzt, im Hochsommer 1949, interessiert sich die Jugend für ein anderes Ereignis: Am 25. Juni werden nach gründlicher „Enttrümmerung“ die ersten Besucher ins Freibad gelassen. Aus alten Feuerlöschern sind Bojen gebastelt worden, und lange Rettungsstangen liegen bereit. Das Wasser im nur teilweise betonierten Becken wird durch eine dichte Schilfkolonie „automatisch“ gereinigt: Die Pflanzen wirken, das hat die Praxis gezeigt, tatsächlich als Schmutzfilter.
Am Tag nach der Freibad-Eröffnung, am 26. Juni, drei Tage vor Wallfahrtseröffnung (Peter und Paul), feiert eine große Menschenmenge die Stadtwerdung, und zwar angemessen ruhig, so wie Kevelaer auch 1903 - nach dem Tod des Wallfahrtsrektors van Ackeren - die vorbereiteten Festivitäten zur Rathauseröffnung zurückgefahren hat. Während der Stadterhebungsfeier liegt die sterbliche Hülle von Wilhelm Holtmann in der Beichtkapelle aufgebahrt. Sein Begräbnis ist das erste in der jungen Stadt Kevelaer.
Zur Geburt des ersten Kindes nach der Stadterhebung werden eine Urkunde und ein Sparkassenbuch mit einem Guthaben von 100 D-Mark den Eltern übergeben. Der erste Ostheimkehrer erhält neben der üblichen Bekleidungsbeihilfe ebenfalls 100 Mark geschenkt. Während sein Name nicht überliefert ist, kennen wir das Ehrenpatenkind der Stadt: Das Mädchen heißt Maria Kammans, heute Lemmen, geboren am 26. Juni 1949.
Der Brief, den die Eltern erhalten, stammt vom 1. Juli und ist auf einfachem Schreibpapier getippt, ausgefertigt im Amt Kevelaer, Abteilung 2, schwungvoll unterschrieben von Amtsbürgermeister Peter Plümpe und Amtsdirektor Fritz Holtmann. In dem Brief an die Familie des Bauarbeiters Anton Kammans (Bahnstraße 20) heißt es u.a.: „Ihrer Familie wurde die Ehre zuteil, der neuen Stadt die erste neugeborene Stadtbürgerin zu schenken.“
Am Tag der Stadterhebung führt Kevelaer sein neues Wappen ein: vorne blau mit goldenem Kreuz, hinten gelb mit grünem Kleeblatt. Es bleibt bis zur Kommunalen Neuordnung gültig; 1969 wird es durch das heutige ersetzt.
Aber nicht nur in Kevelaer wird um einen Verstorbenen getrauert. Am Tag der Stadterhebungsfeier stirbt in Wetten Bürgermeister Mathias Selders (71). Er ist seit Kriegsende im Amt gewesen.
Juli 1949
Die Welt dreht sich weiter. Am 4. Juli ist Hauptfesttag der Kirmes in Winnekendonk. Nachmittags geht es im Festzug durch das Dorf.
In der Tat haben die Menschen Grund zur Freude: Die Lebensmittelversorgung klappt inzwischen, und das Kreisernährungsamt in Geldern ist voller Zuversicht nach der neuen Ernte. Das Elend mit den Lebensmittelkarten hört auf. Das wird in Geldern auf sarkastisch-drastische Weise gefeiert: Mitglieder des dortigen Bergknappenvereins „Glück auf“ treten in Trauerkleidung und mit Zylinder zur „Bestattung“ des Kartensystems auf dem Hof der Stadtverwaltung an.
Sehr viel kleiner sind die Papiere, mit denen sich die Kevelaerer beschäftigen, die am 27. Juli zum ersten Mal im Hotel „Weißes Kreuz“ tagen: Es sind die Briefmarkensammler, die sich bald zu einem Verein zusammenschließen werden.
August 1949
Zwischen Einheimischen und Flüchtlingen kommt es immer wieder zu Unstimmigkeiten. In Kevelaer wird ein kleiner „Ausschuss für die Beseitigung von Streitfragen“ gebildet - bestehend aus zwei Vertretern der Flüchtlinge und einem der „Eingesessenen“.
Viele Probleme können nun auf dem „kleinen Dienstweg“ geklärt werden.
Der neue Pfarrer für die Wallfahrtsstadt ist weitgehend unbekannt. Man liest, dass er gebürtig aus Rindern ist und 1934 seine Priesterweihe empfangen hat. Viel mehr haben die Zeitungen noch nicht über den unbekannten Geistlichen zu berichten: Heinrich Maria Janssen, der später Bischof von Hildesheim werden wird.
| Kapitel 1 von 115 |
![]()
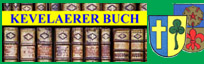 |
INHALTSVERZEICHNIS |
|
|
|
|
![]()