 |
 |
 |
  |

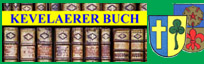 |
INHALTSVERZEICHNIS |
|
|
|
|
| Kapitel E |
Am 31. März 1949, so weist es ein Verwaltungsbericht aus, leben in Kevelaer 922 Vertriebene und Flüchtlinge. Damit ist fast jeder zehnte Einwohner der 10.000-Seelen-Gemeinde kein Einheimischer.
Mitte April begeben sich Frauen und Männer mit Schippe und Hacke zur zerstörten St.-Antonius-Kirche. Es ist der Auftakt zu einer Aufräumaktion, die in erster Linie den Weihestätten der Marienstadt gilt. Auch Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung beteiligen sich und tauschen den „Federhalter mit dem Spaten“, wie eine Zeitung schreibt. In den nächsten Wochen packen auch die Nachbarschaften an. Trümmer und Schuttreste sollen an allen markanten Punkten der Stadt beseitigt werden - die Wallfahrtszeit steht bevor.
Es sind die letzten Wochen und Monate vor Gründung der Bundesrepublik Deutschland. Seit dem 8. April ist das Drei-Mächte-Abkommen ausgehandelt, das den Deutschen für den Zeitraum, „in dem die Besatzung notwendig ist“ das „größtmögliche Maß an Selbstregierung“ zugesteht. Das Abkommen, das Ende September 1949 in Kraft treten wird, macht den Weg in einen neuen Staat frei.
Zeitgleich wird in Kevelaer der Grundstein für die neue St.-Josef-Kapelle gelegt - als Ersatz für die in den letzten Kriegsmonaten zerstörte Kapelle. Die St.-Josef-Bruderschaft, der vorwiegend katholische Handwerker angehören, sorgt mit eigenen Mitteln für den Neubau an der Ecke Twistedener/Kroatenstraße. Kaplan Fritz Dyckmans sieht in dem Engagement der Bruderschaft eine „Hinwendung zu christlichen Werten“. Der Krieg habe nicht nur materielle Schäden, sondern auch „geistig-seelische Schäden“ hinterlassen.
Zwei Tage nach der Grundsteinlegung gründen in Twisteden auf Initiative von Pastor August Hegenkötter Bürger in der Gastwirtschaft Heuvens einen Sportverein. Die Gemeinschaft ist bewusst christlich orientiert und kirchlich verfasst: Deutsche Jugendkraft Schwarz-Weiß Twisteden.
Im April 1949 wird geradezu pausenlos verhandelt. In Frankfurt treffen sich Vertreter des Parlamentarischen Rates mit den alliierten Militärgouverneuren, um Auswirkungen des Besatzungsstatus zu besprechen. Diesmal geht es besonders um die Frage der Polizeigewalt in der neuen Republik und um Wahlgesetze.
Am 24. April wird der bis zuletzt von den Fraktionen immer wieder debattierte Entwurf des Grundgesetzes in dritter Lesung vom Parlamentarischen Rat angenommen. Damit kann das grundgesetzliche Fundament, auf dem die neue Bundesrepublik Deutschland stehen soll, baldmöglich endgültig verabschiedet werden.
Anfang Mai wird in Kevelaer das Jubiläum „300 Jahre Kerzenkapelle“ mit Weihbischof Dr. Gleumes gefeiert. Gerhard Kaenders eröffnet nach Rückkehr aus der Gefangenschaft sein Herren- und Knaben-Konfektionsgeschäft an der Busmannstraße 37 wieder. 55 Jahre zuvor ist es gegründet worden. Ebenfalls Anfang Mai 1949 verabschiedet die St.-Quirinus-Schützenbruderschaft eine neue Satzung. Es ist der 8. Mai 1949, der Tag, an dem mit 53 von 65 Stimmen - gegen CSU, KPD, DP und Zentrum - das Grundgesetz verabschiedet wird.
Zwei Tage danach entscheidet sich der Parlamentarische Rat mit 33 Stimmen für Bonn als Hauptstadt der künftigen Bundesrepublik. 29 Abgeordnete plädieren für Frankfurt am Main. Am 12. Mai akzeptieren die westalliierten Militärgouverneure das Grundgesetz, betonen aber ihre Rechte als Besatzer. Am selben Tag heben die Sowjets die Berlin-Blockade auf. Für Berlin, die ehemalige Hauptstadt, gilt ein besonderes Besatzungsstatut.
Während die Westdeutschen vor der Gründung ihres neuen Staates stehen, geschehen in Kevelaer sonderbare Dinge. In der Marienstadt kursieren Gerüchte, eine teilweise gelähmte Frau sei bei ihrem Besuch der Gnadenkapelle geheilt worden.
Die Frau heißt Maria Offermanns, 1903 in Aachen-Brand geboren und seit 1948 erheblich gehbehindert. Die an Multipler Sklerose erkrankte Frau kann sich nur zentimeterweise vorwärtsbewegen und schließt sich dennoch einer Wallfahrt ihrer Gemeinde nach Kevelaer an. Unter Aufbietung aller Kräfte schleppt sie sich betend über den Kreuzweg und lässt sich zur Gnadenkapelle fahren.
„In dem Moment, als ich das Gnadenbild sah, fing ich laut an zu schreien“, schrieb sie später in einem Brief. Viele Ohren- und Augenzeugen erleben, was nun geschieht. Maria Offermanns schreit mehrmals: „Hilf Maria, es ist Zeit, ... es ist die höchste Zeit!“ Und sie löst sich von ihren drei Helfern, die sie stützen, und kniet nieder. Niemand um sie herum rührt sich. „Liebe Mutter Gottes, ich kann doch knien, dann lass’ mich doch noch einmal gehen“, betet sie. Auf einmal steht die Frau auf, begibt sich zum Gnadenbild, küsst es dreimal, kniet wieder hin und sagt: „Liebe Mutter Gottes, du hast mir geholfen.“
Erst als Maria Offermanns ohne Hilfe aufsteht und sich auch beim Gehen nicht mehr helfen lassen muss, begreifen die Umstehenden, dass etwas Wunderbares geschehen sein muss.
Während in Kevelaer selbst die Spontanheilung der Maria Offermanns eher zurückhaltend beurteilt wird, spielen sich bei der Rückkehr der Pilger nach Aachen-Brand ergreifende Szenen ab. Hier wird offen von einem Heilungswunder gesprochen.
Aber auch wenn sich das Priesterhaus mit offiziellen Verlautbarungen zurückhält, ist in diesen Tagen die Trösterin der Betrübten in aller Munde. Sie wirkt auch Wunder, die auf den ersten Blick nicht als solche erkennbar sind. Nazi-Deutschland hatte Holland überfallen. Und doch pilgern am 19. Mai 1949 fromme Frauen aus Nimwegen in das Land, das ihnen Schlimmes angetan hat. Es ist die erste Wallfahrt der Holländer nach dem Krieg - weit mehr als zehntausend Pilger werden in der neuen Wallfahrtszeit folgen.
Für die ersten Pilger aus Holland - es sind ausnahmslos Frauen - reist der Rundfunk an und berichtet über das Ereignis. Die Pilgerbusse werden am Grenzübergang bei Wyler gestoppt. Sie dürfen - so lauten die Vorschriften - nur bei Venlo die Staatsgrenze passieren.
Die etwa 160 Holländerinnen werden in Kevelaer begrüßt wie alte Freunde, die sich jahrelang nicht gesehen haben. In der Basilika, wo sie einen Gottesdienst feiern, predigt Kaplan Fritz Dykmans in fließendem Niederländisch: Seit der letzten Prozession aus Holland sei „Unermeßliches an Gut und Blut“ geopfert worden. Eine der bedauerlichsten Hinterlassenschaften des Krieges stelle jedoch die Mauer des Hasses und des Misstrauens dar. Sie habe zwei Völker voneinander getrennt, die im Wesen so viel Gemeinsames hätten. Um so erfreulicher sei, dass gerade Frauen und Mütter den „versöhnenden Weg über die Grenze“ gefunden hätten.
Es ist der Aufbruch in ein friedliches Zeitalter - im Kleinen wie im Großen. In der zweiten Mai-Hälfte ratifizieren die Landtage von zehn Ländern das Grundgesetz; Bayern lehnt es als „zu zentralistisch“ ab. In der Schlusssitzung des Parlamentarischen Rates am 23. Mai 1949 wird das Grundgesetz ausgefertigt und feierlich verkündet. Damit ist die Bundesrepublik Deutschland - noch ohne Regierung und höchste Repräsentanz - geboren.
Bei der ersten Bundestagswahl am 14. August erringt die CDU 31 % der Stimmen, gefolgt von SPD (29,2 %), FDP (11,9 %), KPD (5,7 %), Bayernpartei (4,2 %), Deutscher Partei (4 %) und Zentrum (3,1 %).
Der erste Bundespräsident, im zweiten Wahlgang von der Bundesversammlung am 12. September gewählt, ist Theodor Heuss (FDP). Konrad Adenauer (CDU) wird drei Tage danach der erste Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland - mit 202 gegen 142 Stimmen bei 44 Enthaltungen. Für Adenauer ist, wie er schon in seiner ersten Regierungserklärung vom 20. September 1949 betont, die Westintegration der Bundesrepublik vorrangig gegenüber dem Ziel der Wiedervereinigung.
40 Jahre werden die Deutschen auf die Vereinigung warten müssen.
| Kapitel E |
![]()
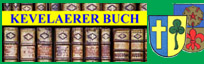 |
INHALTSVERZEICHNIS |
|
|
|
|
![]()