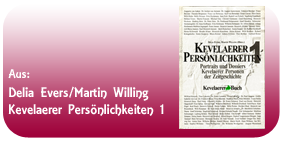|
 |
 |
  |

|
Bergmann, Theodor
Heimatdichter und Schuhfabrikant | * 1868 | † 1948
![]()
 Der Schöpfer des Kevelaerer Heimatliedes „Wor hör ek t´hüss“ wurde Ende
1868 in dem Haus Nummer 28 auf der heutigen Basilikastraße geboren, dort
wo seit 1985 dank einer Initiative der Nachbarschaft Basilikastraße ein
Denkmal auf das Wirken des Schuhfabrikanten und Heimatdichters Theodor
Bergmann hinweist. Die dort aufgestellte Bronzebüste ist von dem
Kevelaerer Bildhauer >
Will Horsten in Gips etwa 1946/47 geschaffen
worden. Das Horsten-Werk wird im >
Museum aufbewahrt.
Der Schöpfer des Kevelaerer Heimatliedes „Wor hör ek t´hüss“ wurde Ende
1868 in dem Haus Nummer 28 auf der heutigen Basilikastraße geboren, dort
wo seit 1985 dank einer Initiative der Nachbarschaft Basilikastraße ein
Denkmal auf das Wirken des Schuhfabrikanten und Heimatdichters Theodor
Bergmann hinweist. Die dort aufgestellte Bronzebüste ist von dem
Kevelaerer Bildhauer >
Will Horsten in Gips etwa 1946/47 geschaffen
worden. Das Horsten-Werk wird im >
Museum aufbewahrt.
Den Menschen in der Marienstadt fühlte sich Theodor Bergmann innig
verbunden. Er genoß schon in jungen Jahren Ansehen in der Bevölkerung.
Als die offizielle Geburtsstunde des Sängerbundes am 6. November 1898 im
Vereinssaal bei Wwe. Peter Schell („Heidelberger Faß“) gefeiert wurde,
lauschten Vorsitzender Hermann Tauwel, Dirigent Peter Sieben und
zahlreiche Zuhörer der Festansprache, die Theodor Bergmann angetragen
worden war. Zur Fahnenweihe, die Bürgermeister Gerhard Leeuw vornahm,
hatte Bergmann ein Gedicht verfaßt, das den Titel „Die Fahne hoch“ trug
- ein Titel, der als Plagiat Jahrzehnte später in äußerst unangenehmem
Zusammenhang wieder auftauchte.
1915 erschien im Thomas-Verlag Kempen Theodor
Bergmanns erste größere Dichtung - das Volksschauspiel „Der Schmied von
Kevelaer“. Bergmann arbeitete eng mit Goldschmied
>
Ludwig Freudenhammer
jr., dem Vorsitzenden des Vereins für Heimatschutz e.V. Kevelaer, aber
auch mit Sanitätsrat Dr. Franz Oehmen, Kunstmaler
>
Heinrich Holtmann,
Goldschmied Johann Vorfeld und Lehrer >
Carl Schumacher zusammen. Auf
sie geht maßgeblich die Ausgestaltung des ersten Museums Kevelaer („Haus
der Heimat“) „in de alde Weem“ zurück. Der Heimatdichter, der den
Museumsverein von 1923 bis 1939 selbst führte, hatte zusammen mit seinen
Freunden in vielen Gesprächen, Verhandlungen und auch Bittgängen die
Voraussetzungen für ein solches Museum geschaffen.
Zu Bergmanns 77. Geburtstag erschien im Geldrischen Heimatkalender 1939
der Nachdruck einer Würdigung, die zum 65. Geburtstag verfaßt worden
war:
„Und ihm, dem Freund seiner Heimat, zu Ehren die seiner Schlichtheit entsprechenden wenigen und schlichten Worte, die ihm bei der Vollendung des 65. Lebensjahres die Schrift der niederrheinischen Heimatfreunde, des Vereins Linker Niederrhein, widmete: ´Glühende Heimatliebe und tiefe Religiösität, der sittliche Ernst eines arbeitsreichen Lebens und der feine Humor einer Persönlichkeit, die alle Widerwärtigkeiten gemeistert hat, machen Theodor Bergmann zum innigsten unserer niederrheinischen Mundartdichter. Man muß diese scheinbar so einfach gesetzten und inhaltlich anspruchslosen Lieder, in denen der Dichter durch Wald, Feld und Heide seiner niederrheinischen Heimat schreitet, alte Freunde und Stätten durch die Erinnerung ziehen läßt und sich in einen beglückenden Lebensabend hineinträumt, aus des Dichters eigenem Munde gehört haben, um den Wohlklang seiner feinen Sprache und den Zauber seiner unverfälschten Art ganz empfinden zu können.‘“
Ein Jahr später - 1940 - veröffentlichte Theodor Bergmann im Geldrischen Heimatkalender den Beitrag „Unsere Mundart“, die wohl niemand besser beurteilen könnte:
„Leider fehlte es uns am unteren Niederrhein von jeher an mundartlicher Literatur oder vielmehr an der schönen Literatur überhaupt. Ob die schwere Luft des Niederrheins keinen Höhenflug zuläßt? Das kann man im allgemeinen nicht sagen. Wir haben auf anderen Kunstgebieten Hervorragendes geschaffen, auf dem Gebiete der Malerei, der Bildhauerei, der Goldschmiedekunst usw. Allerdings besteht zwischen diesen Künsten und der Dichtung insofern ein Unterschied, als die letztere mittels der Sprache das Schöne darstellt, die anderen dagegen mittels der Farbe, des Holzes, der Töne usw. Vielleicht haben wir für das eine Geschick, für das andere aber nicht. Seit jenen Tagen, als Heinrich von Veldecke am Hofe des Herzogs von Kleve seine Minnelieder sang - es war um das Jahr 1200 -, ist auf dem Gebiete der schönen Literatur am Niederrhein wenig zutage gefördert worden. Allerdings ließen die fürchterlichen Kriege, die im 17. und 18. Jahrhundert den Niederrhein verwüsteten, keine hohen geistigen Interessen hochkommen. Auch mag in den Kriegswirren manches verlorengegangen sein.“
Bis heute berühmt ist Bergmanns 1929 bei
>
Butzon & Bercker erschienenes Buch „Maisüches on Heijblumme“, das 1939
eine zweite Auflage erfuhr. Diese Dichtung in Kävels Platt ist als
Nachdruck heute wieder im Handel erhältlich.
Theodor Bergmann, der Heimatschützer und Heimatdichter, war ein
erfolgreicher Schuhfabrikant, der unter anderem mit
>
Wilhelm Otterbeck in
Kervenheim standespolitisch zusammenarbeitete. Als ehemaliger
Reichstagsabgeordneter war er zudem längst als politischer Mitgestalter
ausgewiesen, als es 1946 darum ging, eine Kevelaerer Ortsgliederung der
Nachkriegspartei CDU ins Leben zu rufen. Bergmann lud zur
Gründungsversammlung für einen solchen Ortsverband ins „Heidelberger
Faß“ (am Platz der heutigen Pax-Christi-Kapelle) ein und wurde zum
ersten Vorsitzenden gewählt. Bergmanns Stellvertreter wurde Wilhelm Herx
und Heinrich Urselmann, Kassierer Joseph Berger und Schriftführer Joseph
Tenhaef, der als Jupp Tenhaef in die Fußstapfen des Heimatdichters stieg
und bis heute als einer der profundesten Kenner des Kävels Platt gilt.
1948 mußte Kevelaer Abschied nehmen von seinem „großen Sohn“, der
79-jährig starb. Mit seinem bekanntesten Werk, dem Heimatlied „Wor hör
ek t´hüss“, wachsen seit Generationen die Kevelaerer auf. In diesem Lied
lebt Bergmann fort. Vertont wurde es von Gerhard Korthaus, der von 1890
bis 1927 Basilikaorganist in Kevelaer war. Bergmann und Korthaus waren
Freunde. Den Text hatte Bergmann 1910 verfaßt. Der Dichter gab das Werk
dem begabten Komponisten Korthaus zu lesen, der gleich sagte: „Ich hab
schon die Melodie!“ Und in wenigen Tagen war das vielgesungene
Heimatlied geboren.
Wor hör ek t’hüß?
Wor hör ek t’hüß? - kent gej min Land?
Gän Baerge schnejbelaeje
Gän driewend Water träckt en Band
Voerbej an grote Staeje:
Dor, wor de Nirs doer’t Flackland gätt
Wor in dem Baend et Maisüt stätt
On wor de Keckfoars quakt in’t Lüß,
Dor hör ek t’hüß.
Wor op de Heij de Loewrek sengt,
Den Haas sprengt doer de Schmeele,
Wor ons de ricke Sägen brengt
De Aerbeijshand voll Schweele,
Wor in et Koarn de Klappros droemt,
Van Faeld on Weije rond ömsoemt
So frindlek roest et Burenhüß
Dor hör ek t’hüß.
Wor gärn de Lüj en oapen Hand
In Not de Noaber reike,
Foer Gott on Kerk on Vaderland
Noch faas ston, as de Eike.
Wor maenn’gen Drömer, maenn’ge Sock
So gut es, as den andern ok.
Wor saelde Strit on grot Gedrüß,
Dor hör ek t’hüß.
Pries gej ow Land mar allemoal
In Nord, Ost, Süd on Weste,
- Ok maenn’ge grote Noet, es hoal -
Min Laendche es et beste!
Hier stond min Wieg, hier lüjt mej ok,
So Gott well, eins de Dojeklock.
Dann schrieft mej op et steene Krüß:
Hier hört hän t’hüß!
![]()