 |
 |
 |
  |

 |
INHALTSVERZEICHNIS |
|
|
|
|
| Kapitel 3 |
MARTIN WILLING
Mein Vater
Er gab sein Leben für die Patienten. Einer nahm es ihm
Die Marienbasilika in Kevelaer ist fast menschenleer. Das Brautpaar wird nur von vier Verwandten begleitet. Es kommt sich verloren vor in der großen Kirche. Am Altar steht Julius Willing, der spätere Rektor der Wallfahrt Marienbaum. Er traut seinen Neffen Heinrich und dessen Verlobte Christel. Ganz hinten in der Basilika steht Heinrichs Vater und Julius’ Bruder, der Bauunternehmer Bernhard Willing aus Kamp-Lintfort. Der korpulente Mann leidet, auch in dem majestätischen Gotteshaus, unter Platzangst und bleibt lieber in der Nähe des Ausgangs - selbst an diesem Festtag seines Sohns.Es ist Dienstag, der 17. September 1940.
Nach der Trauung begibt sich die sechsköpfige Hochzeitsgemeinde ins Hotel „Zu den goldenen und silbernen Schlüsseln“ am Kapellenplatz. Das Hotel serviert zu dem Aufschnitt, den die Gäste mitgebracht haben, Brot und Kaffee. 25 Jahre später werden meine Eltern im selben Haus auch ihre Silberhochzeit feiern.
Meine Mutter trägt damals, an ihrem Hochzeitstag im Jahr 1940, ein schlichtes, gut wieder verwendbares Kostüm. Ihr Brautstrauß besteht aus drei Astern. Von Kevelaer fährt die Hochzeitsgesellschaft nach Kamp ins Elternhaus, wo Julius, der Priester, eine Kerze segnet. Weitere Geschenke bekommt das Paar nicht. Am Nachmittag bringt Peter, der Chauffeur des Bauunternehmers, die Brautleute nach Duisburg. Christel und Heinrich Willing fahren mit dem Zug nach Münster, wo in der Hammerstraße ihre erste gemeinsame Wohnung wartet.
Mit dem Marienwallfahrtsort Kevelaer sind sie verbunden, obwohl sie nicht von hier stammen. Heinrich Willing - 1912 in Kamp geboren, dort aufgewachsen, Abitur am Adolfinum in Moers, Medizinstudium in Freiburg, Düsseldorf und Münster - ist seit 1937 promovierter Facharzt für Neurologie und Psychiatrie. Als der junge Arzt 1938 praktische Erfahrungen am Marienhospital in Soest sammelt, lernt er die dort beschäftigte Krankenschwesternhelferin Christel Huckebrinker aus Bochum kennen, Tochter eines Reichsbahnbeamten.
Nach drei Monaten ohne private Kontakte lädt der junge Arzt die Krankenschwester zum Eis-Essen ein. Gleich beim ersten Rendezvouz verblüfft er sie mit der Frage: „Wollen Sie mich heiraten?“Wenige Monate später spricht Heinrich Willing bei Christels Eltern in Bochum vor und hält um die Hand der Tochter an. Weihnachten 1939 ist Verlobung, im September darauf die kirchliche Trauung.
Heinrich Willing ist inzwischen in einer Klinik in Köln-Lindental als Arzt tätig. Wenig später liegt er dort - als Patient: Nach einem Motorradunfall kuriert er länger als neun Monate eine schwere Knieverletzung aus.Während ihr Mann im Krankenhaus liegt, muss Christel ihre Wohnung in der Stadt Münster, die bereits Anfang 1941 bombardiert wird, verlassen.
Sie ist mit ihrem ersten Kind Bernd schwanger und wird in die Kleinstadt Nieheim im Kreis Höxter evakuiert, wo Bernd am 20. August 1941 zur Welt kommt. Einen Tag nach der Geburt erreicht ein Telegramm die Mutter. Einer ihrer Brüder, Josef, ist am ersten Tag des Russlandfeldzuges gefallen. Als Bernd sechs Wochen alt ist, reisen Mutter und Kind nach Köln zur Klinik, wo der Vater liegt. Zum ersten Mal sieht er seinen Sohn.
Bald nach Christels Rückkehr in ihren Evakuierungsort Nieheim wird Dr. Heinrich Willing als Stabsarzt in Allenstein in Ostpreußen eingesetzt. Hier führt er ein Lazarett für verwundete Soldaten von der Ostfront. Als 1942 bekannt wird, dass die Wohnung in Münster bei einem Bombenangriff beschädigt worden ist, bekommt Heinrich Sonderurlaub, reist nach Münster, organisiert bei einem befreundeten Bauern ein Pferdegespann für die Wohnungseinrichtung - und kommt mit leeren Händen bei seiner Frau in Nieheim an: Die Wohnung ist nach dem Bombenangriff restlos ausgeplündert worden.
Nicht nur deswegen, sondern auch wegen der schlimmen Nachrichten von der Ostfront nimmt Heinrich Willing bedrückt seine Arbeit in Allenstein wieder auf.Im Oktober des Kriegsjahres 1943 werde ich als zweites Kind in Nieheim geboren. Einen Monat später übernimmt mein Großonkel Julius Willing die Wallfahrtspfarrei Marienbaum. Mit mir im Körbchen - Bruder Bernd kann schon laufen - reist meine Mutter Weihnachten 1943 nach Ostpreußen. Im Lazarett wird neben dem Zimmer meines Vaters ein Raum für die Familie hergerichtet, wo wir ein Vierteljahr leben.
Die Front rückt zwar näher, aber in Allenstein geht das Leben außerhalb des Lazaretts noch seinen gewohnten Gang. Zum ersten Mal seit Jahren kann meine Mutter Aufführungen von Theater und Operetten erleben; mein Vater besorgt ihr die Eintrittskarten und passt abends mit Begeisterung auf die beiden kleinen Kinder auf. Bernd sieht in Allenstein den ersten Storch seines Lebens.
Im Frühjahr 1944 wird es gefährlich in Ostpreußen. „Es wird Zeit, dass wir hier weg kommen“, sagt meine Mutter in einem Geschäft zu der Inhaberin. Die antwortet: „Sie glauben doch wohl nicht, dass der Führer auch nur einen Russen in unser Land lässt!“ Ein zugeordneter „Bursche“ meines Vaters begleitet meine Mutter mit den Kindern nach Nieheim, wo die Familie - ohne den Vater - auf das Kriegsende wartet.
Es wird Herbst 1944. Der zweite Bruder meiner Mutter - Josef ist bereits gefallen - wird in Rußland schwer verwundet. Heinrich Huckebrinker, so sein Name, wird zusammen mit anderen Verwundeten nach Riga ausgeflogen, aber das Flugzeug wird getroffen und muss notlanden. Unter den Überlebenden befindet sich auch Heinrich, den man in dem Chaos liegen lassen will. Er schreit seinen flüchtenden Kameraden hinterher. „Den Hucki nehmen wir mit“, sagt einer, und Heinrich („Hucki“) schafft es tatsächlich bis zu einem Zug Richtung Westen. In Höhe Allenstein wird der lebensgefährlich verletzte Heinrich wach, hört den Namen „Allenstein“ und verlangt, abgesetzt zu werden. „Mein Schwager ist hier Arzt“. Bald darauf sehen sich mein Vater und mein Onkel im Lazarett wieder.
Der Arzt erkennt sofort, dass Heinrich nicht zu retten ist. „Wenn du ihn noch mal sehen willst, musst du kommen“, schreibt er an meine Mutter in Nieheim. Sie fährt tatsächlich los, während die Kinder in der Obhut von Nonnen im Krankenhaus von Nieheim bleiben. Christel findet ihren Bruder Heinrich querschnittsgelähmt vor, einen Fuß amputiert. Sie nehmen Abschied von einander und sehen sich nicht wieder.
Heinrich, der nach dem Krieg Theologie studieren wollte, wird mit Auflösung des Allensteiner Lazaretts zusammen mit anderen Verwundeten abtransportiert. Er schafft es noch bis Merane in Sachsen. Hier stirbt er am 21. November 1944 und wird auf einem Soldatenfriedhof beerdigt.
Als ich in den 1990er-Jahren im Winter diesen Friedhof in Merane besuche, sind die Grabplatten der dort liegenden Soldaten zugeschneit. Ich streiche, Platte für Platte, den Schnee weg und sehe schließlich den Namen vor mir: Heinrich Huckebrinker.Kurz vor der Auflösung des Lazaretts in Allenstein sorgt mein Vater mit einer absichtlichen Falschdiagnose dafür, dass ein Rechtsanwalt seinen verwundeten Sohn nach Hause in den Westen mitnehmen darf. Der junge Mann hätte eigentlich zurück an die Ostfront gemusst. Als der letzte verwundete Soldat zum Allensteiner Bahnhof gebracht ist, beginnt auch für meinen Vater die Flucht vor den Russen. Er schließt sich einem Treck an und wandert in Halbschuhen über das zugefrorene Haff Richtung Danzig.
Eisbrecher zerstören immer wieder das Eis, und die Flucht droht mehrmals vor unüberwindbaren Wasserrinnen zu enden. Über Balken, die im Eiswasser schwimmen, kriechen die Menschen von Scholle zu Scholle. Mein Vater, der wegen seines versteiften Knies gehandicapt ist, muss aufrecht und balancierend über solche Balken gehen. Als der Treck auf festes Eis stößt, kann sich mein Vater beim Gehen an einem Pferdewagen festhalten. Eine alte Frau schaut heraus und sagt zu ihm: „Ich sehe an Ihrer Uniform, Sie sind Arzt. Sagen Sie meiner Tochter, dass ihr Kind tot ist“. Zusammen mit der Frau begräbt mein Vater das Kind im Schnee.
Auf der gesamten fürchterlichen Wegstrecke von Alleinstein bis Danzig ist ein anderer Arzt an der Seite meines Vaters, ein Mann, der sich tapfer hält. In Danzig angekommen, bricht kurz vor der Rückmeldung beim Corpsarzt das ganze Elend des Kriegs und der Flucht über ihm zusammen. Er nimmt seine Walther-Pistole und erschießt sich im Vorzimmer des Vorgesetzten.
Dabei ist die Rettung nah. Danzig hat keine neuen Befehle für den Stabsarzt Dr. Heinrich Willing. Er soll sich, so wird ihm gesagt, nach Westen durchschlagen. Rette sich, wer kann. Bis Greifswald kommt er, teils mit dem Zug, teils zu Fuß, dann fast immer allein auf den Straßen. Als er ankommt, hat er Erfrierungen an den Füßen. Das Lazarett in Greifswald hilft, und vor allem: Es ist von den Alliierten besetzt. Der Krieg ist aus.
Eines Tages klopft jemand an die Tür des Krankenzimmers, und ein Soldat tritt ein, dem mein Vater im Lazarett Allenstein einen voluminösen falschen Verband angelegt hat, damit er nach Sachsen ausreisen darf, wo er seine Familie vermutet.
Im späten Frühjahr 1945, Deutschland kapituliert, geht meine Mutter im verschont gebliebenen Örtchen Nieheim mit uns Kindern spazieren. Frauen aus dem Dorf kommen vorbei. Meine Mutter hört, wie eine sagt: „Das ist sie!“
Sie erwartet schon das Schlimmste, als sie erfährt, dass mein Vater telegrafiert hat: Schon bald trifft er in Nieheim ein. Er kommt zu Fuß. Nach dem Wiedersehen ist Nieheim der schönste Ort der Welt.
Heinrich Willing will möglichst schnell wieder als Arzt arbeiten und denkt zunächst an eine Niederlassung in Münster. Aber auch Herne - wo Christel Willing aufgewachsen ist - und Moers sind in der Wahl. Die Entscheidung fällt auf Moers, weil Heinrichs Vater, der Bauunternehmer aus Kamp-Lintfort, die Familie in der Nähe wissen will. Am 5. Dezember 1945 lässt sich Dr. Heinrich Willing als Facharzt für Neurologie und Psychiatrie in Moers nieder - ein Glücksfall für die vielen zurückkehrenden Hirnverletzten, denn viele Jahre gibt es im Altkreis Moers und darüber hinaus keinen zweiten Nervenarzt. Die Praxis, die von der Militärbehörde sofort genehmigt wird, weil der Arzt nie Parteimitglied gewesen ist, wächst zu einer der damals größten am Niederrhein heran - in der Spitze mit über 2.000 „Scheinen“ pro Quartal.
Bei der Suche nach einem Praxisraum hilft ein Schulkamerad vom Adolfinum, Dr. med. Karl-Friedrich Grafer, in dessen Elternhaus am Königlichen Hof die Praxis Dr. Willing eingerichtet werden darf. Jetzt, einen Monat nach ihrer Eröffnung, kann er seine Familie nachkommen lassen. Er schickt seine Putzfrau Gertrud, unser späteres Kindermädchen, nach Nieheim, um Frau und Kinder abzuholen. Bei Duisburg stehen sie vor dem Rhein und setzen mit einem wackeligen Kahn über. Von Homberg bis Moers fahren sie mit der Straßenbahn. Es ist Januar 1946: Als die Familie aus der Straßenbahn am Königlichen Hof aussteigt, sieht Christel Willing an einem Fenster des Grafer-Hauses einen Mann im weißen Kittel stehen.
Neben der Ein-Raum-Praxis befindet sich ein Zimmer - die Wohnung der vierköpfigen Familie. Der ersten Patientin nach Praxiseröffnung, der Frau eines Schiffers aus Homberg, überreicht Heinrich Willing von nun an bei ihren jährlichen Besuchen einen Blumenstrauß.
Ein bekannter Krankenhausarzt gibt dem neu niedergelassenen Mediziner „kein halbes Jahr in Moers“ - als Katholik in der damals durch und durch evangelisch geprägten Kreisstadt. Aber die immer zahlreicher werdenden Patienten sehen das lockerer, und wer kein Geld hat, zahlt mit Naturalien: Rübenkraut, Wurst, Eier.
Heinrichs Vater lässt das kriegsbeschädigte Haus Grafer abdichten und baut auf seine Kosten eine Wohnung in der zweiten Etage aus, in der die Arztfamilie bis 1952 wohnt.
Am 2. Januar 1947 kommt als drittes Kind Christa zur Welt. Zur selben Zeit erkrankt der Vater an Gelbsucht. Der behandelnde Arzt aus dem St.-Josefs-Krankenhaus rät dringend dazu, für Vitaminzufuhr zu sorgen, was er keineswegs sarkastisch meint: Er weiß, dass es im Elternhaus von Heinrich Willing in Kamp-Linfort an nichts mangelt. Dort herrscht nach dem Tod von „Mütterchen“, wie sie genannt wird, und dem Einzug der Stiefmutter ein anderer Geist. Halbschwester Marianne - sie wird später Ärztin - bringt ein Einmachglas mit Erdbeeren vorbei, aber mit dem Hinweis, mehr sei beim besten Willen nicht drin. Heinrich Willing lässt das Glas unberührt und verteilt die Erdbeeren an seine Kinder.
Das Jahr 1948 zieht ins Land, und in Homberg wird Günther Horst H. geboren, jener H., der 27 Jahre später meinen Vater niederstechen wird. Aber jetzt, nach der Währungsreform, geht es erst einmal aufwärts.
Am 23. März 1950 kommt das vierte Kind meiner Eltern auf die Welt - Ulrich, über den ich im Krankenhaus gesagt haben soll: „Ich will kein Brüderchen, sondern ein Fahrrad.“ Meine Eltern kaufen von der katholischen Pfarrgemeinde St. Josef in Moers ein Trümmergrundstück an der Uerdinger Straße Nr. 20, wo mein Großvater, der Bauunternehmer, auf seine Kosten ein Haus für Praxis und Wohnung baut. Mein Vater stottert die Baukosten über viele Jahre mit einer fest liegenden monatlichen Zahlung bei meinem Großvater ab.
Jahrzehnte später, lange nach dem Tod meines Vaters, muss meine Mutter das Haus im Zuge einer Erbauseinandersetzung mit der Halbschwester meines Vaters noch einmal bezahlen. Die früheren Geldüberweisungen, längst abgehakt und vergessen und auch bei der überweisenden Kasse nicht mehr dokumentiert, lassen sich nicht rechtswirksam nachweisen. Über diese durch Prozess erzwungene Doppelzahlung zerbrechen die Familienbande nach Kamp-Lintfort, wo die Halbschwester Anfang der 90er-Jahre vereinsamt stirbt.
Als meine Eltern 1962 in Moers auf der Filderstraße ein neues Wohnhaus bauen - hier lebt heute meine über 90-jährige Mutter mit Bruder Bernd -, ist ein gewisser bürgerlicher Wohlstand eingekehrt. Bei Wilhelm Polders in Kevelaer kauft mein Vater den ersten Brillantring seines Lebens für meine Mutter - nie hat er später anderswo Schmuck erworben. Mit jedem Besuch in der Marienstadt ist verbunden, dass am Kapellenplatz eine Kerze angezündet wird. Und mit jedem seiner vier Autos, die er in seinem Leben gekauft hat, steuert er auf der Jungfernfahrt zuerst Kevelaer an.
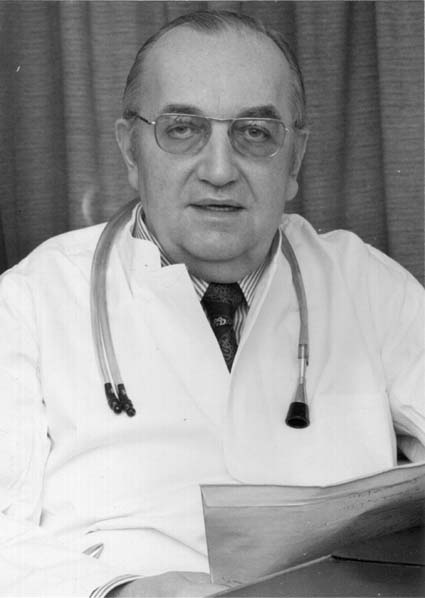 Immer noch und bis in die
1970er-Jahre ist er der
einzige Nervenarzt im weiten Umkreis. Besonders die Hirnverletzten
liegen ihm am Herzen. Seinen Gutachten, die er in ungezählten Nächten
diktiert, verdanken Tausende von Patienten die Grundlage, mit der sie
ihre Versorgungsansprüche gegenüber den Leistungsträgern durchsetzen
können.
Immer noch und bis in die
1970er-Jahre ist er der
einzige Nervenarzt im weiten Umkreis. Besonders die Hirnverletzten
liegen ihm am Herzen. Seinen Gutachten, die er in ungezählten Nächten
diktiert, verdanken Tausende von Patienten die Grundlage, mit der sie
ihre Versorgungsansprüche gegenüber den Leistungsträgern durchsetzen
können.Dr. med. Heinrich Willing im Jahr 1972 an seinem 60. Geburtstag.
Solange sein Vater in Kamp-Lintfort noch lebt, besucht er ihn jeden Sonntag. Das wöchentliche Ritual ist bei den Kindern sehr beliebt: Eines von ihnen nimmt er stets mit - zuerst in die heilige Messe in der Klosterkirche zu Kamp, dann zum Opa, wo es so seltene Köstlichkeiten wie Kirschsaft oder Schokolade gibt. Zu besonderen Anlässen wird dem Enkelkind auch ein nagelneuer Geldschein geschenkt.
Mein Großvater, der zu jener Zeit bei der Sparkasse Kamp-Lintfort die einstellige Kontonummer 3 besitzt, akzeptiert grundsätzlich nur neue Scheine. „Hat Opa selbst gemacht“, pflegt er zu den Kindern zu sagen. Er ist eine Institution in Kamp und Kamp-Lintfort, ein Patriarch, zu dem Patres aus dem Kloster, Vertreter der Kirchen- und weltlichen Gemeinde gerne kommen, weil es diesem sonderbaren Mann Freude macht, mit seinen reichen Möglichkeiten zu helfen.Zu jener Zeit, Anfang der 1960er-Jahre, wird Günther Horst H., der meinen Vater überfallen wird, in eine Sonderschule überwiesen, die er 1963 aus der 6. Klasse verlässt. Anschließend geht er zunächst als Schiffsjunge in die Binnenschifffahrt. Dann wird er Eisenanstreicher, wechselt häufig die Arbeitsstelle und wird zwischenzeitlich arbeitslos.
Im Herbst 1968 wird H. zur Bundeswehr eingezogen, muss sich zweieinhalb Monate in der Universitätsklinik in Göttingen einer stationären Behandlung unterziehen und leidet seit 1964 an Schlafstörungen, Angstgefühlen und Minderwertigkeitserlebnissen. „Derealisations- und Depersonalisationssyndrom im Rahmen einer Reifungskrise“ lautet die Diagnose. Anfang 1970 wird H. vorzeitig aus der Bundeswehr entlassen. Seitdem hat er keine Arbeit mehr. Am 27. Mai 1970 erscheint H., zu diesem Zeitpunkt 22 Jahre alt, erstmals bei meinem Vater in der Praxis, wie im späteren Gerichtsprozess bekannt wird.
Es ist das Jahr, in dem sich mein Vater über die Geburt seines ersten Enkels freuen darf. „Die immer noch knappe Freizeit widmet Dr. Willing seinem Garten in der Filderstraße. Seit anderthalb Jahren hat er noch ein zweites Hobby: sein Enkelkind Jan“, schreibt die WAZ Anfang 1972 zum 60. Geburtstag meines Vaters.

Mit unserem kleinen Sohn Jan erholten wir uns an den Wochenenden als Dauercamper auf dem Campingplatz am Eyller See. Seine Mutter Ingrid und ich (r.) hatten früh Gefallen gefunden an diesem unkomplizierten Leben in der Natur. Das Bild zeigt unseren ersten Wohnwagen und davor Jans Oma Anfang der 1970er-Jahre.
Nach mehrmonatigen Aufenthalten in einer Krefelder Klinik wird H. im Frühjahr 1971 mit der Diagnose „Psychose aus dem schizophrenen Formenkreis“ entlassen. Im Hochsommer 1971 wird H. im Landeskrankenhaus Bedburg-Hau aufgenommen, weil ein Gutachten für ihn als Frührentner erstellt werden soll. Dort kommt es nach wenigen Tagen zu einem akuten Wiederaufflammen der Psychose. Er steht unter wahnhaften Erlebnissen, fühlt sich hypnotisiert, sieht aus dem Essen rote Dämpfe ausströmen und verweigert die Nahrungsaufnahme. Die akute Psychose klingt unter Einsatz von Psychopharmaka ab. Er wird am 19. November 1971 unter der Auflage einer weiteren Behandlung durch einen Facharzt - er bleibt bei meinem Vater in Behandlung - entlassen. Mitte 1973 wird er erneut im Landeskrankenhaus Bedburg-Hau wegen akuter Auffälligkeiten untergebracht. Auch diesmal wird H. bei der Entlassung geraten, weiterhin in fachärztlicher Behandlung zu bleiben. Aber er bricht die Behandlung durch meinen Vater am 8. November 1974 ab und begibt sich in die Obhut eines praktischen Arztes.
Bereits in 1974 beschleicht meinen Vater das Gefühl, von H. verfolgt zu werden. Er trifft ihn, scheinbar zufällig, häufiger in der Stadt. Als er seinen Patienten einmal auf der Straße direkt anspricht, was das solle, bekommt er zur Antwort: „Ich kenne Sie nicht“.
H. entwickelt sich zu einer akuten Gefahr, die aber von Dritten nicht erkannt wird. Als er 1974 erneut nach Bedburg-Hau eingewiesen wird (Diagnose: „Debilität mit aufgepfropfter Schizophrenie“), wird der Unterbringungsbeschluss gegen den ärztlichen Rat aufgehoben - weil die Mutter Rechtsmittel eingelegt hat. Ihr Sohn H. wird entlassen. Das Gericht geht davon aus, dass der Mann keine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung darstellt. So heißt es in dem Beschluss.
Im Lauf der nächsten Zeit konzentrieren sich die Wahnvorstellungen von H. immer stärker auf meinen Vater. Er treibt sich häufiger in der Nähe der Arztpraxis herum, auch noch wenige Tage vor dem Überfall. Im Urteil wird es später heißen: „Am 5.12.1975 entschloß der Beschuldigte sich endgültig, seinen Plan, Dr. Willing zu töten, in die Tat umzusetzen, um sich von dessen ‘Einfluß’ zu befreien. Er hatte bewußt noch bis zum Winter gewartet, damit er dem Arzt auf dem Heimweg von der Praxis zur Wohnung im Schutze der Dunkelheit auflauern konnte.“
Die Tat geschieht am Freitag, 5. Dezember 1975, am Vorabend von Nikolaus. Mein Vater verlässt kurz nach 18 Uhr seine Praxis und will zu seinem Wagen gehen, der auf einem Parkplatz an der Kautzstraße, einer nahen Nebenstraße, steht. Im Dunkeln hat H. schon auf seinen früheren Arzt gewartet. Plötzlich verspürt mein Vater mehrere heftige Schläge gegen seinen Rücken. Dass es vier Messerstiche sind, wird ihm zu diesem Zeitpunkt nicht bewusst. Er dreht sich halb um und erkennt das Gesicht des Patienten.
Mein Vater kann sich zurück in sein Praxishaus schleppen, wo in der ersten Etage der frühere Kripochef von Moers, Kriminaldirektor Oswald Heuchert, wohnt. Heuchert leistet erste Hilfe, alarmiert einen Krankenwagen, und der Schwerverletzte kommt auf die Intensivstation des Bethanienkrankenhauses. Einer der Messerstiche, knapp an der Wirbelsäule vorbei, hat eine tiefe Wunde hinterlassen, aber schon bald nach der Einlieferung ist die Lebensgefahr zunächst gebannt.
Die Sprechstundenhilfe meines Vaters erinnert sich an den Namen des Patienten, über den man sich früher schon öfter unterhalten hat, weil er für gefährlich gehalten wurde. H. ist auch polizeilich bekannt, unter anderem wegen Widerstands gegen Beamte, weshalb die Polizei mit größerem Aufgebot um 22.30 Uhr zu dessen Wohnung ausrückt. Aber der Mann, zur Tatzeit 27, wirkt apathisch und kann ohne Probleme festgenommen werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erlässt ein Richter einen Unterbringungsbefehl nach Bedburg.
Mein Vater bleibt bis zum 19. Dezember 1975 im Krankenhaus und hält sich ab dem 5. Januar 1976 wieder für arbeitsfähig. Wenige Tage später setzt im Landeskrankenhaus Bedburg-Hau die behandelnde Ärztin bei H. die Psychopharmaka ab, um durch Veränderung feststellen zu können, welche Erkrankung bei H. vorliegt. Ohne den Einfluss der Medikamente gibt H., wie die Ärztin später als Zeugin vor Gericht erklärt, am 17. Januar 1976 eine geständnisgleiche Schilderung der Tat und seiner Motive ab, wiederholt sie zwei Tage später vor der Polizei. Später aber, auch im Gerichtssaal, beteuert er, dem Arzt nicht aufgelauert zu haben. Er sei den ganzen Abend zu Hause gewesen. Das vom Gericht als eindeutig falsch eingestufte Alibi wird ihm von seinen Familienangehörigen gegeben.
Es kommt in dieser Zeit - am 15. Januar - zu einer folgenschweren Begegnung. Nach seiner ersten Fahrt im eigenen Auto - die Tage vorher hat er ein Taxi benutzt - wird mein Vater auf dem selben Parkplatz von einem Mann unbeabsichtigt angerempelt. Mein Vater, der an einen zweiten Überfall glaubt, stürzt schockiert in seinen geöffneten Wagen und kann sich von dem Schrecken kaum erholen. Seine Niedergeschlagenheit wegen des Umstands, dass ihn ausgerechnet ein Patient angegriffen hat, schlägt in Depression um. Als er acht Tage später von der Polizei auch noch erfährt, dass der Täter ihn tatsächlich hat ermorden wollen, steht er unmittelbar vor dem tödlichen Herzinfarkt, der am 27. Januar 1976, morgens um 5.40 Uhr, eintritt. Nach zwei Tagen im Bethanienkrankenhaus wissen seine Angehörigen, dass kaum noch Hoffnung besteht.
Am 30. Januar, seinem 64. Geburtstag, sieht mein Vater alle Familienangehörigen an seinem Bett stehen. Er glaubt, das Aufgebot diene seinem Geburtstag. Deswegen fährt mein Bruder Bernd nach Hause und holt die Flasche Sekt, die mein Vater einige Tagen zuvor zum Anstoßen auf den Geburtstag in den Kühlschrank gelegt hat.

Am vorletzten Tag seines Lebens bereitet ihn sein Lebensfreund, der Pallotinerpater Prof. Dr. med. Dr. phil. Dr. theol. Gustav Vogel aus Vallendar, der als Facharzt für Neurologie und Psychiatrie für meinen Vater so manche Praxisvertretung während der Ferien übernommen hat, auf das Sterben vor. Sie sind eine lange Zeit allein im Krankenzimmer.
Gustav Vogel, Freund meines Vaters.
In den wenigen Stunden, die noch bleiben, ist seine ganze Familie bei ihm. Am 2. Februar 1976 schläft er friedlich ein. Am Fenster steht eine Kerze. Ich zünde sie an, als mein Vater ins nächste Leben übergeht.
Die Auswärtige Strafkammer in Moers des Landgerichts Kleve verkündet am 22. Juni 1976 ihr Urteil „in der Strafsache gegen Günther Horst H., ledig, Deutscher, z.Zt. Rheinisches Landeskrankenhaus Bedburg-Hau wegen versuchten Mordes“: „Die Unterbringung des Beschuldigten in einem psychiatrischen Krankenhaus wird angeordnet.“ Der Beschuldigte hat die Tat nach Einschätzung des Gerichts zwar begangen, bestraft werden aber kann er nicht, weil er krank ist.
Das Gericht sieht keinen kausalen Zusammenhang zwischen den Messerstichen und dem wenige Wochen später eingetretenen tödlichen Herzinfarkt; ohnehin ist strafrechtlich wegen der Schuldunfähigkeit des 27-Jährigen ohne Belang, ob Mordversuch oder Mord vorliegt.Diese Frage hat allerdings zivilrechtlich große Bedeutung. Der Kevelaerer Rechtsanwalt Klaus Hölzle, der meine Mutter schon während des Strafprozesses für die Nebenklage vertreten hat, begleitet erfolgreich meine Mutter durch ihr Verfahren vor dem Sozialgericht Duisburg gegen eine Berufsgenossenschaft in Hamburg, die einen Zusammenhang zwischen Überfall und Tod nicht anerkennen und somit keine Witwenrente zahlen will.
Der renommierte Sachverständige Prof. Dr. Hauss aus Münster liefert die entscheidende Grundlage für das Gericht, indem er die zu untersuchende Frage, ob „der Überfall auf den Ehemann der Klägerin vom 5.12.1975 dessen Tod in einem erheblichen Maße mitverursacht“ hat oder ob „dessen Leben infolge der Folgen des Überfalls mindestens um ein Jahr verkürzt worden“ ist, im wichtigsten Punkt bejaht und begründet. Danach ist mein Vater zwar wegen erheblicher Vorschädigungen des Herzens hochgradig gefährdet gewesen, aber er hätte ohne den Überfall mit seinen niederschmetternden Erfahrungen, so das Gutachten, „wesentlich länger, das heißt etwa 1 Jahr“ noch leben können. Das Gericht verurteilt die Berufsgenossenschaft im Sommer 1978 zur Zahlung einer Witwenrente.
Pater Vogel, der Freund meines Vaters seit Studienzeiten, stirbt am 2. Januar 1986. In einem Nachruf eines Mitbruders in der Ordenszeitschrift „Pallottis Werk“ (3/1986) befasst sich der Autor unter der Überschrift „Seelenleiden und Seelsorge“ auch mit dem Fall meines Vaters. Nach dem Herzinfarkt „ging P. Vogel unter Verschiebung aller anderen Termine in die Praxis und wickelte sie ab, als dann sein Freund gestorben war. Es war ärztliche Tätigkeit und Seelsorge zugleich!“ In den vielen Jahren, da er den „Doktor Willing“ während der Ferien vertreten hat, haben viele Patienten den Pater im weißen Arztkittel schätzen gelernt, wahrscheinlich ohne zu wissen, dass ihnen ein Priester zuhörte. Im Zuhören-Können - auch darin waren die beiden Freunde seelenverwandt.
| Kapitel 3 |
 |
INHALTSVERZEICHNIS |
|
|
|
|